Zusätzliche Reinigungsstufe in Kläranlagen
EU-Kommunalabwasserrichtlinie (KARL): Strengere Regeln und mehr Herstellerverantwortung
Die Neuauflage der EU-Kommunalabwasserrichtlinie KARL führt eine vierte Reinigungsstufe für Kläranlagen ein und bittet Hersteller von Arzneimitteln und Kosmetika zur Kasse. Sie tragen mindestens 80 Prozent der Kosten für den Ausbau der Abwasseranlagen.
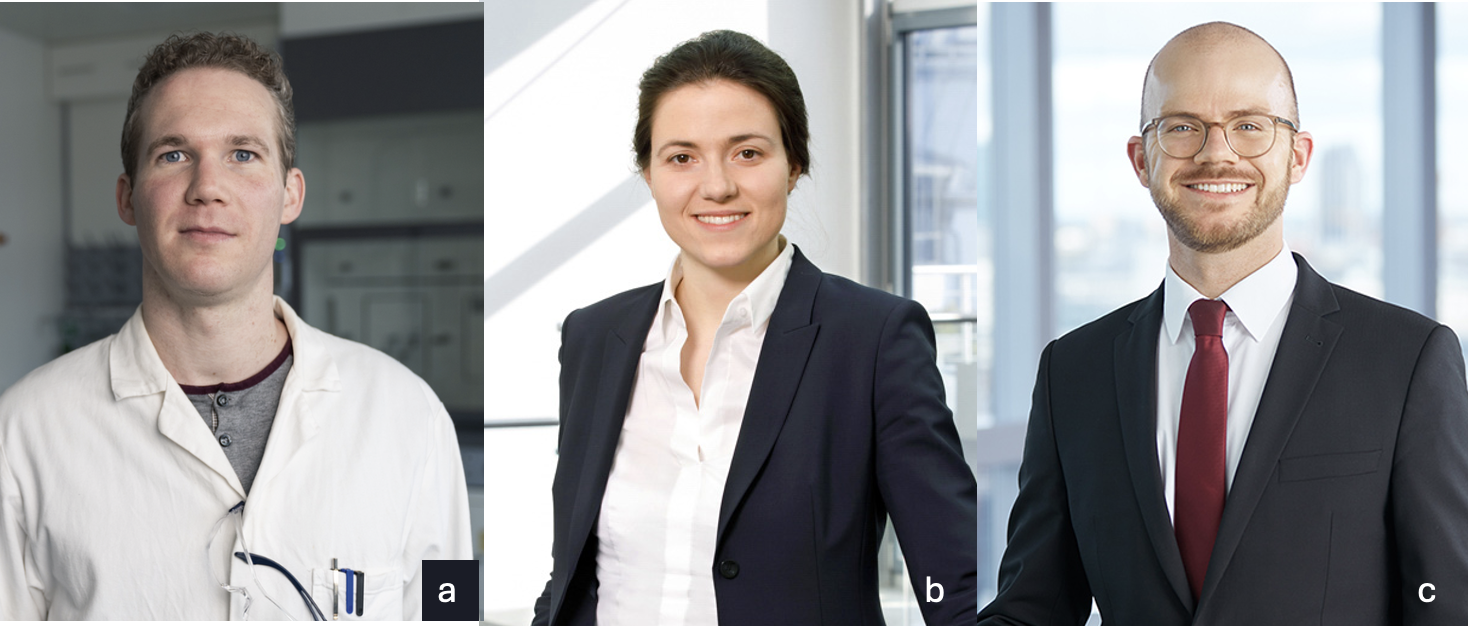 Dr. Benjamin Wriedt vom Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, Copyright: Fraunhofer IGB (a); Dr. Andrea Sautter (b) und Kris Breudel (c) von der Kanzlei Taylor Wessing, Copyright: Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB
Dr. Benjamin Wriedt vom Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, Copyright: Fraunhofer IGB (a); Dr. Andrea Sautter (b) und Kris Breudel (c) von der Kanzlei Taylor Wessing, Copyright: Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbBDie Neuauflage der EU-Kommunalabwasserrichtlinie (EU) 2024/3019, kurz KARL genannt, ist am 01.01.2025 in Kraft getreten. Sie soll Mikroverunreinigungen in Abwässern wirksamer beseitigen und setzt dafür neue, strengere Grenzwerte fest. Ein zentrales Element ist der verpflichtende Ausbau einer 4. Reinigungsstufe in großen kommunalen Kläranlagen – und die Kostentragungspflicht für Unternehmen. Was das für die Pharma- und Kosmetikbranche bedeutet, und welche zusätzlichen Kosten dadurch entstehen könnten, erläutern Dr. Benjamin Wriedt vom Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB sowie Dr. Andrea Sautter und Kris Breudel von der Kanzlei Taylor Wessing.
Das Problem: Mikroschadstoffe im Abwasser
Moderne Kläranlagen schaffen es, selbst feine Partikel aus dem Abwasser zu filtern. Hierzu kommt meist ein dreistufiges Filtrationssystem zum Einsatz: mechanisch, biologisch und chemisch. Doch Mikroschadstoffen, also winzigen Rückständen von Arzneimitteln, Kosmetika, Pflanzenschutzmitteln und Industriechemikalien, sind diese drei Stufen meist nicht gewachsen. „Diese Stoffe sind anthropogenen Ursprungs und stellen eine wachsende Herausforderung für die Wasserwirtschaft dar“, erklärt Wriedt. Besonders kritisch sind dabei unter anderem Arzneimittel und Kosmetika. Sie gelangen täglich zum Beispiel über Dusche oder Toilette ins Abwasser. „Gerade, weil es so winzige, aber stabile Stoffe sind, sind sie mit den klassischen Reinigungsverfahren oft nur schwer zu entfernen.“ Dass sie sich deshalb im Wasser und in biologischen Organismen anreicherten, mache sie für die Umwelt problematisch.
Von der Kommunalabwasserrichtlinie der EU aus dem Jahr 1991 waren diese Mikroschadstoffe kaum erfasst, da sich die Regelungen auf grobe organische Belastungen und Nährstoffe konzentrierte. Mit der Neuauflage der Kommunalabwasserrichtlinie von 2024, kurz KARL, schließt die EU diese Lücke. Unter anderem wird mit ihr eine vierte Reinigungsstufe für Kläranlagen verpflichtend, die auch Spuren von Medikamenten und Kosmetika entfernen kann. Außerdem werden Unternehmen maßgeblich an den Kosten beteiligt, die dadurch entstehen, dass ihre Produkte in die Umwelt gelangen. Sie müssen künftig 80 bis 100 Prozent der Reinigungskosten übernehmen.
Zusätzliche Reinigungsstufen werden verpflichtend
KARL sieht mehrere Reinigungsstufen in kommunalen Kläranlagen vor. Die erste Stufe ist die mechanische Reinigung, die grobe Schmutzpartikel herausfiltert. Danach folgt mit der zweiten Reinigungsstufe eine biologische Behandlung, die vor allem organisch abbaubare Stoffe entfernt. Die Zweitbehandlung ist ab dem 31.12.2035 auch für Einleitungen aus kommunalen Kläranlagen mit einem Einwohnerwert von 1.000 bis 2.000 verpflichtend. „Einwohnerwert (EW)“ ist dabei eine fiktionale Rechengröße, die ausdrückt, wie stark das Abwasser verschmutzt ist. Einwohnerwert 1 wäre die Menge von Abwasser, die ein einzelner Mensch pro Tag verursachen würde.
Die dritte Reinigungsstufe dient der Entfernung von Stickstoff- und Phosphorverbindungen. Diese Nährstoffe können Gewässer belasten und zu deren Überdüngung (Eutrophierung) führen. Eine Drittbehandlung ist für Kläranlagen mit mehr als 10.000 EW vorgesehen, die in Gebiete einleiten, die von Eutrophierung betroffen oder bedroht sind, sowie für Anlagen mit 150.000 EW und mehr.
Neu hinzu kommt außerdem eine vierte Reinigungsstufe, die für Kläranlagen in Städten ab 150.000 EW verpflichtend ist. In besonders gefährdeten Gebieten gilt diese Pflicht bereits ab einer Größe von 10.000 EW. Sie soll gezielt Mikroschadstoffe wie Medikamentenrückstände oder Kosmetika aus dem Wasser entfernen. Für ihre Einführung gilt ein gestaffelter Fahrplan: Bis zum 31.12.2033 müssen mindestens 20 Prozent der Kläranlagen mit 150.000 EW und mehr über eine vierte Reinigungsstufe verfügen, bis zum 31.12.2039 sind es 60 Prozent und bis spätestens zum 31. Dezember 2045 alle Anlagen dieser Größe.
Die Richtlinie verpflichtet die Betreibenden der Kläranlagen jedoch nicht nur, diese technischen Anforderungen umzusetzen, sondern auch nachzuweisen, dass sie tatsächlich wirksam sind. Das Ziel ist, im Durchschnitt mindestens 80 Prozent bestimmter organischer Mikroschadstoffe zu entfernen. Dafür wird die Leistung anhand der Entfernung von mindestens sechs ausgewählten Stoffen überprüft. Wichtig ist die Auswahl der Stoffe aus bestimmten Kategorien, wobei Stoffe, die die Richtlinie als Kategorie 1 = „sehr leicht zu behandeln“ einstuft (wie Carbamazepin und Diclofenac), doppelt so häufig vertreten sein müssen wie Stoffe der Kategorie 2 = „leicht zu entfernen“. Aus den Entfernungswerten dieser mindestens sechs Stoffe wird dann ein Mittelwert berechnet, um die tatsächliche Wirksamkeit der Reinigung festzulegen. „Das zwingt die Betreiber zu einer lückenlosen Dokumentation und einer regelmäßigen Überwachung der Reinigungsergebnisse“, sagt Wriedt. „Nur so lässt sich sicherstellen, dass die neue Technik nicht nur eingebaut, sondern auch wirksam genutzt wird.“
Das Verursacherprinzip und die erweiterte Herstellerverantwortung
Neu ist bei alldem nicht nur die Technik, sondern vor allem die Kostenfrage. Bei KARL gilt das Verursacherprinzip: Hersteller von Humanarzneimitteln und Kosmetika, durch deren Produkte am Ende Mikroschadstoffe im Abwasser landen, müssen künftig einen erheblichen Teil der Kosten für die Abwasserreinigung tragen. Rechtsanwältin Sautter betont: „Die Richtlinie verankert das Verursacherprinzip auf Basis der Menge und Toxizität der in Verkehr gebrachten Produkte. Die Hersteller von Arzneimitteln und Kosmetika müssen künftig mindestens 80 Prozent der Kosten für Ausbau und Betrieb der vierten Reinigungsstufe sowie für die Überwachung des Abwassers übernehmen.“ Darüber hinaus müssten sie auch 100 Prozent der Kosten für die Datenerhebung und -überprüfung sowie für „Sonstige Kosten“ tragen. Damit solle ein Ausgleich für ihre wirtschaftliche Tätigkeit geschaffen werden, die später für die Öffentlichkeit durch die notwendige Reinigung Kosten verursache.
Die neue Richtlinie verlangt außerdem, dass Hersteller jährlich detaillierte Berichte über die in Verkehr gebrachten Mengen, deren Abbaubarkeit und mögliche Umweltgefahren vorlegen. „Jährlich müssen die Hersteller der jeweiligen nationalen Organisation für die Herstellerverantwortung mitteilen, wie viel und welche Produkte sie in Verkehr bringen, und welche Risiken diese Stoffe für das Abwasser haben“, erklärt Sautter.
Ausgenommen von diesen Pflichten sind lediglich Hersteller, die weniger als eine Tonne kritischer Stoffe in den Produkten nachweisen, die sie pro Jahr in der EU verkaufen, oder die belegen können, dass ihre Produkte im Abwasser entweder schnell biologisch abbaubar sind oder keine Mikroschadstoffe freisetzen.
Umsetzung und Widerstand
Die Mitgliedstaaten haben bis 31.07.2027 Zeit, KARL in nationales Recht umzusetzen. Ab Ende 2028 gilt die erweiterte Herstellerverantwortung rechtsverbindlich. Doch bereits seit einer Weile regt sich Widerstand. Grund ist vor allem die aufwendige Überwachungspflicht und die vorgesehene Kostenbeteiligung für Unternehmen. Kritisiert wird die zeitlich unbegrenzte Kostentragungspflicht sowie die Auswahl der als Verursachende ausgemachten Herstellenden ohne Einbeziehung anderer Herstellender von chemischen Produkten. Branchenverbände wie BAH, BPI, ProGenerika und VFA werfen der EU-Kommission vor, die finanziellen Auswirkungen für betroffene Hersteller und die Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln in der EU zu unterschätzen. Sie beziffern die Kosten allein für die deutsche Pharmaindustrie in den nächsten 30 Jahren auf über 36 Mrd. Euro. „Seit Anfang März 2025 klagen mehrere Pharmaunternehmen beim Gericht der Europäischen Union gegen die Richtlinie“, berichtet Rechtsanwalt Breudel. „Dabei geht es nicht um die Absenkung von Umweltstandards, sondern die Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte. Gerade bei Arzneimitteln könnten die Kosten der erweiterten Herstellerverantwortung ergänzend zur bestehenden Preisregulierung die Herstellung von Produkten betreffen.“
Ob die Kommunalabwasserrichtlinie angesichts der Klagen tatsächlich in allen Punkten Bestand haben wird, ist ungewiss. „Es ist denkbar, dass die Gerichte bestimmte Vorschriften kippen oder zumindest entschärfen“, erklärt Sautter. „Gleichzeitig werden aber viele der neuen Pflichten wohl bestehen bleiben. Unternehmen müssen sich daher auch in dieser unsicheren Situation vorbereiten.“ Sie empfiehlt betroffenen Herstellern, ihre Produkte und Prozesse genau zu prüfen und schon jetzt alle relevanten Daten und Nachweise sorgfältig zu dokumentieren. „Wer frühzeitig handelt, kann Kosten reduzieren und Haftungsrisiken minimieren“, so Sautter.
Breudel rät, die Entwicklung der nationalen Umsetzungen und der laufenden Verfahren genau zu verfolgen: „Viele Unternehmen unterschätzen die Dynamik, die hier entsteht. Jetzt ist der Zeitpunkt, rechtlich sowie produktseitig strategische Optionen auszuloten und gleichzeitig die technische Anpassung nicht aus den Augen zu verlieren. Denn auch, wenn sich bestimmte Fristen oder Kostenanteile noch ändern sollten, bleibt die Richtung klar: Die Regulierung der Ressource Wasser wird zunehmen, und wie es bereits andere Bereiche vormachen, sollen auch hier die Kosten immer häufiger von bestimmten Branchen übernommen werden, die als Verantwortliche ausgemacht werden.“